Faszination Pfahlbauten – zwischen Fakten und Fantasie
Was wissen wir wirklich über das Leben in den prähistorischen Pfahlbauten? Und was ist vielleicht mehr Vorstellung als Wirklichkeit? Der Blogbeitrag geht der Faszination für die jungsteinzeitlichen Siedlungen am Zürichsee nach – zwischen Forschungsgeschichte, archäologischen Funden und der Macht der Bilder.







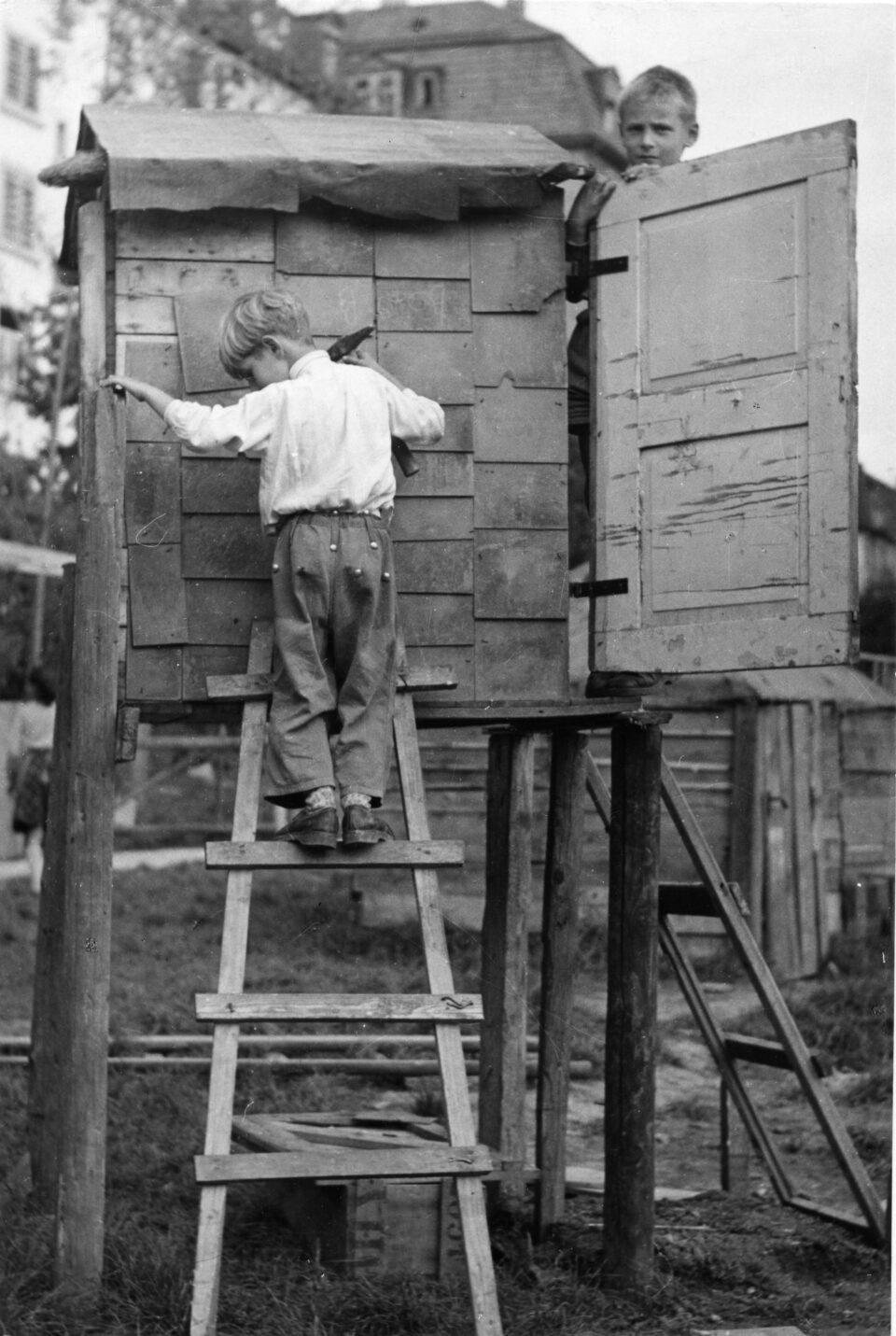
Schreiben Sie einen Kommentar: